
Das mediale Übergewicht der Polemiker, die sich über unser Zeitalter auslassen, ist eine Reaktion auf die dreifache anthropologische Revolution, der wir uns gegenübersehen: eine Revolution, die
zugleich ökologischer und geopolitischer Natur ist, die bis in unser Privatestes und Persönlichstes reicht und welche die westlichen Gesellschaften insgesamt auf den Prüfstand stellen wird.
Wie sind wir nur an diesen Punkt gelangt? Ein scheinbar miefiges, piefiges Frankreich, in dem eine medial dominante, reaktionäre Rechte mit ihren Themen nach Belieben den öffentlichen Diskurs
bestimmt. Eine zersplitterte, zerstrittene, nicht der Erneuerung fähige Linke, die sich selbstverliebt um die eigene Achse dreht und dabei demontiert. Der übliche Konservatismus und eine auf
Abwegen geratene Zukunftsgläubigkeit; ein Universalismus vermischt mit Eurozentrismus. Und ein Antirassismus, den manche schon mit Totalitarismus gleichsetzen, dessen neue Formen wenig rühmlich
als „Islam-Linke“ (franz. islamo-gauchisme) bezeichnet werden
und sich des „Wokismus“ verdächtig machen. Ein Feminismus, der sich heutzutage in seiner
Opfermentalität gefällt. Eine für das Klima massenhaft auf die Straße gehende Jugend, die mit Ajatollahs gleichgesetzt wird, und eine ökologische Bewegung, die in manchen Augen Züge einer
säkularen Religion hat. Den Universitäten wird unterstellt, streitbares, ja militantes Wissen zu verbreiten und sich unverständlicher Theorien zu bedienen. Das einstmals Richtige erscheint nun
falsch. Gutes wird zu etwas Bösem. Und der Gutmütige ist am Ende der Idiot.
.Es ist zweifellos wichtig zu verstehen, wie die neoreaktionäre Rhetorik und ihre Mechanik funktioniert; genau zu studieren, wieso sie in dem Ausmaß von einem sozial abgeschotteten Milieu und einer gewissen medienwirksamen Klasse mitgetragen wird. Zu verstehen, wie die Entwicklung des intellektuellen und politischen Raumes zu einem Anstieg hin zum Extremen geführt hat, ganz zu schweigen von der Verantwortlichkeit der Linken an dieser kulturellen Niederlage. Eine intellektuelle Konterrevolution, analysiert von der Politologin Frédérique Mantonti, die sich zu verstehen bemüht, warum im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen von 2022 die reaktionäre Ideologie so vorherrschend zu sein scheint.
Vielleicht ist es ja ganz passend, bei den Gründen für eine derartige Restaurationsrede weit auszuholen. Denn die ideologische Trendwende ist zuallererst eine Reaktion auf große gesellschaftliche
Transformationen und auf die anthropologischen Umbrüche. Ein Auf-den-Kopf-Stellen unserer Welt, zugleich ökologischer und geopolitischer Natur, die aber auch die Privatsphäre jedes Einzelnen
betrifft, was die westliche Welt ins Wanken bringt – erschüttert durch eine Reihe neuer narzisstischer Kränkungen. Ausgelöst durch die wissenschaftliche Forschung, hatte Sigmund Freund 1917
erklärt, warum das menschliche Selbstwertgefühl durch drei tiefgreifende Kränkungen herausgefordert wurde. Die erste Kränkung sei eine kosmologische: Wie es der polnisch-deutsche Astronom
Nikolaus Kopernikus (1473–1543) bewies, ist die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums. Die zweite Demütigung ist eine biologische: Der Mensch ist nichts weiter als ein Tier, wie es der
englische Naturwissenschaftler Charles Darwin (1809–1882) demonstrierte. Die dritte Kränkung sei psychologischer Natur: Sie wird durch die Psychoanalyse und seine Theorie des Unbewussten
greifbar, was Freud in die griffige Formel packte: „Das Ich ist nicht der Herr im eigenen Haus.“
Heutzutage scheint der Westen durch eine Reihe von Brüchen und Verwerfungen betroffen zu sein, die zu mancher Orientierungslosigkeit geführt haben, zugleich aber auch neue Horizonte und
Möglichkeiten der Mobilisierung eröffnen. Vor allem ökologisch ist etwas aus dem Lot geraten, wie es uns die Covid-19-Pandemie vor Augen führt, denn die Menschheit befindet sich nicht nur nicht
mehr im vermeintlichen Zentrum der Schöpfung, sondern ihr wird auch durch das Auftreten von Zoonosen oder Laborversuchen auf tragische Weise bewusst, dass sie in engster Abhängigkeit zu anderen
Lebewesen steht und dass sie es selbst ist, die für den eigenen Untergang verantwortlich sein wird. „Ein Virus ist ein Parasit, der sich auf Kosten seines Wirts fortpflanzt oder ihn
schlimmstenfalls sogar tötet“, erklärt der Anthropologe Philippe Descola. „Es ist in etwa dasselbe, was der Kapitalismus seit Beginn des Industriellen Zeitalters unserer Erde antut – leider lange
in Unkenntnis von dessen Folgen. Nun aber kennen wir die Auswirkungen, und scheinen trotzdem Angst vor der Therapie zu haben, der wir uns eigentlich genau bewusst sind und die da heißt: eine
totale Abkehr von unserer bisherigen Lebensweise.
Wie es uns die Erderwärmung immer deutlicher vor Augen führt, ist die auf Ausbeutung ausgelegte Entwicklung der Menschheit zu einer erdgeschichtlichen Macht geworden. Das neue Zeitalter, passend
als Anthropozän oder Kapitalozän bezeichnet, ist nicht einfach nur ein simple Klimakrise, „sondern ein geologisches Aus-den-Fugen-Geraten, das zu einer neuen Conditio Humana führt“, bekräftigt
der Historiker Christophe Bonneuil. „Wir erleben einen anthropologischen Wandel“, stimmt ihm Descola zu, seines Zeichens emeritierter Professor des Collège de Françe. „Wir können die Natur nicht
mehr von der Kultur trennen und müssen künftig eine Welt erschaffen, die wir gemeinsam mit anderen Lebewesen bewohnen, was uns dazu zwingt, unsere anthropozentrische Sicht hinter uns zu lassen.“
Die große narzisstische Unsicherheit
Diese Sichtweise konsequent zu Ende gedacht, bedeutet, dass Ökologie das Ganze umfasst, weshalb ihr vonseiten der Reaktionäre der Vorwurf des Totalitarismus gemacht wird. Ohne auch nur vom
Unbehagen der Neokonservativen zu sprechen, die zwischen Klimaleugnung, den technologischen Herausforderungen und der Verunglimpfung von Umweltschützern (die wahlweise als Amish oder als grüne
Khmer bezeichnet werden) changieren; oder die ZADisten (franz. für
militante Aktivisten/Gegner von [Groß]Projekten), die für gewöhnlich mit „Punks mit Hunden“ (franz. punks à chien, d. h. in Fußgängerzonen herumlungernde Bettler) gleichgesetzt werden; dann die
Animalisten und Veganer oder die Radikalität der Ökofeministen, die –
Schreck lass nach – die Figur der Hexe wieder zum Leben erwecken wollen. Daher auch die „Unsicherheit und Ratlosigkeit gewisser revolutionärer Linker, die mit dem Sprüchen der Vergangenheit heute
noch die Massen zu mobilisieren vermeinen und die sich immer noch an ihr leninistisches Rüstzeug klammern, während wir uns längst in einem neuen Zeitalter befinden“, bemerkt Philippe Descola. In
Anbetracht dieser Flutwelle ist die Versuchung groß, sich an jeden Strohhalm zu klammern und am Altbekannten festzuhalten. „Wir durchlaufen ein Zeitalter, vergleichbar mit dem der Aufklärung im
18. Jahrhundert, in dem einerseits unser Wissen, unsere Methoden auf den Kopf gestellt werden, in dem aber auch neue Ideen sich noch nicht wirklich durchgesetzt haben und zu einem Teil unseres
Allgemeinverständnisses geworden sind. Das erklärt dann auch die Kluft zwischen den im französischen Präsidentschaftswahlkampf geführten Debatten und den tiefgreifenden Veränderungen, in denen
wir uns gerade befinden“, so der Anthropologe.
Die zweite Umwälzung betrifft die Privatsphäre, insbesondere infolge der Verunsicherungen in Fragen des Geschlechts und der Sexualität. Die #metoo-Bewegung und die Einwilligung in sexuelle
Handlungen, die Öffentlichmachung sexualisierter und sexueller Gewalt, Fälle von Inzest und sexueller Belästigung und nicht zuletzt das Ausmaß der Enthüllungen in Sachen Pädokriminalität haben
mit voller Wucht das neoreaktionäre Glaubensbekenntnis getroffen, das die nicht enden wollende alte Leier vom „Man darf nichts mehr sagen, man darf nichts mehr machen.“ anstimmt. Alle
Institutionen und Einrichtungen, die im weitesten Sinne auf den Menschen moralisch oder physisch Einfluss zu nehmen versuchen, sind davon betroffen. Kirche, Armee, Schule, Universität, aber auch
die Familie, Sportclubs und ähnliches: „Das Ende der männlichen Vorherrschaft ist ein gesellschaftliches Erdbeben“, beobachtet der Philosoph Marcel Gauchet. „Dieser Angriff aufs Patriarchat
verursacht Demütigungen und eine große narzisstische Unsicherheit“, so die Psychoanalytikerin und Philosophin Cynthia Fleury.
Wenig erstaunlich, das Eric Zemmour seine Karriere als reaktionärer Verfasser von Pamphleten wie „Das erste Geschlecht“ (Le Premier Sexe) begonnen hat, einem Werk, das als „Abhandlung männlicher
Lebensart“ einer jungen verweich- und verweiblichten Generation anempfohlen wurde. Er verspottet darin das Zeitalter der totalitären Vermischung und des Kastratentums. Daher auch das Bedauern
über die Entpaternalisierung von Autoritäten in unserer Gesellschaft, die Patrick Bouisson, einer der Architekten des Zusammenschlusses der rechten Parteien, äußert. Einer Gesellschaft, in der es
zukünftig weder einen Gott noch überhaupt echte Männer geben wird. Denn die Furcht vor dem großen Austausch, selbst im globalen Maßstab, ist nichts als eine Verschwörungspanik, die einerseits
behauptet, dass Europäer durch Afrikaner ausgetauscht würden, und dass Männer durch Frauen ersetzt werden sollen – so behauptet es jedenfalls der Apologet dieser Theorie, der Schriftsteller
Rénaud Camus.
Die Soziologin Eva Illouz bemerkt wiederum, dass eine kürzlich erschienene Studie von Theresa Vescio und Nathaniel Schemerhorn des Fachbereichs Psychologie der staatlichen Universität von
Pennsylvania gezeigt hat, dass diejenigen Menschen, die hegemonistischen Formen der Männlichkeit anhängen – also jenes kulturelle Modell, dass die Dominanz des Mannes befürwortet –, sich deutlich
stärker für eine Unterstützung des Republikaners Donald Trump aussprechen als für Hillary Clinton oder Joe Bidon, beides Demokraten. Schon seit einiger Zeit sieht man eine Politik des
Ressentiments immer deutlicher Konturen annehmen, ergänzt Cynthia Fleury, in der Wut, Neid, Männlichkeit und Machotum eine vorherrschende Rolle spielen.
„Narendra Modi, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Viktor Orban: alle politisch rechts stehenden Staatsoberhäupter und die, die es werden wollen wie Eric Zemmour, sind leibhaftige Verkörperungen des
Modells der Vorherrschaft des Mannes“, meint Eva Illouz. Feministische, homosexuelle und transgender Bewegungen werden als unmittelbare Bedrohungen dessen erachtet, was für viele das Fundament
ihrer Identität ist: die traditionelle Familie. Männer und Frauen gleichermaßen pflichten dieser Auffassung bei. Vielleicht liefert das eine mögliche Erklärung für die Anwesenheit von
Feministinnen in dieser Welt von Reaktionären, wenn man sich Äußerungen wie „Wo sind all die echten Männer?“ oder „Es gibt einfach keine Kerle mehr!“ aus deren Reihen heranzieht. „Man
unterschätzt die ebenso herausragende wie unterschwellige Bedeutung der Familie innerhalb der Politik“, warnt Eva Illouz. „Sie ist ein Fixpunkt, an dem sich die politischen Gepflogenheiten
ausrichten. Umso mehr, als für die prekär beschäftigten Bevölkerungsschichten die Familie die einzige gesellschaftliche Struktur der gegenseitigen Unterstützung darstellt.“ Die Revolutionen
findet zu Hause statt, die Gegenrevolutionen im Wohnzimmer. Oder um Freud mit anderen Worten zu zitieren: „Die persönliche Erschütterung und Verunsicherung verursacht eine Kränkung innerhalb der
eigenen vier Wände. Der Mann ist nicht mehr länger der Herr im Hause.“
Die dritte Umwälzung ist geopolitischer Natur. Wir erleben eine Welt, die aus den Fugen gerät, mit einem Europa, das sich nicht mehr im Zentrum befindet. Was einst Zentrum war, wurde nun an den
Rand gedrängt. Frankreich ist nach den Worten von Valérie Giscard d’Estaing (1926–2020) eine „Mittelmacht“, ein Ausdruck, der damals nicht wohlgelitten war. Doch der Rückstand der französischen Pharmaindustrie, einen Covid-Impfstoff herzustellen, oder der
U-Boot-Streit zwischen Frankreich
und Australien, sind mehr als eindeutige Belege dafür. Die Schmach ist geblieben. Und daher rührt auch die immerwährende Suche nach der eigenen vergangenen Größe. „Im Grunde versuchen Reaktionäre
wie Eric Zemmour einen auf Trump zu machen: Make France great again!“, ist Cynthia Fleury überzeugt. Überdies treten immer neue Sichtweisen, neue Forschungsergebnisse zutage – globaler Natur, die
Welt im Allgemeinen betreffend, postkoloniale, antikoloniale –, die Fragen rund um Rasse und Geschlecht aufwerfen und die in der Folge von Veröffentlichungen des amerikanisch-palestinensischen
Literaturtheoretikers Edward Said oder der indischen Mitbegründerin der
postkolonialen Theorie Gayatri Spivak
publiziert wurden.
Originalartikel „Ces idéologies néoréactionnaires qui refusent les bouleversements du monde! erschienen am 15. Januar 2022 in der Printausgabe der Le Monde. Verfasser: Nicolas Truong. Erweiterte Übersetzung.
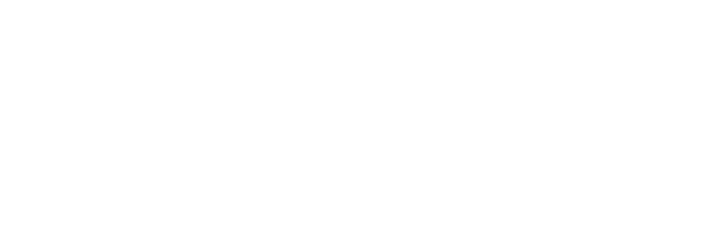
Kommentar schreiben