
„Eine Kritik am Universalismus, die sich universell geriert; eine dekoloniale Sichtweise, die zwar nicht relativistisch ist, die aber dem Pluralismus in der Welt Bahn bricht:“, fasst der senegalesische Philosoph Souleymane Bachir Diagne, Professor an der Columbia-Universität zusammen. „Europa steht für das Universelle und der Rest der Welt richtet sich danach aus: Diese Idee geht mindestens auf Hegel zurück, für den ein Weltwinkel erst dann zu existieren beginne, wenn er in den Fokus von Europa gerate oder wenn ein Europäer seinen Fuß darauf setze. Eine Aussage wie „Christoph Kolumbus hat 1492 Amerika entdeckt“ ist völlig absurd, je länger man darüber nachdenkt: Wenn Amerika tatsächlich „entdeckt“ worden sei, dann sicherlich durch die indianischen Völker“, so die pointierte Feststellung des Philosophen. „Es geht auch darum, Europa zu „provinzialisieren“, also aus dem Macht- und Herrschaftszentrum zu entfernen“, so der indische Historiker Dipesh Chakrabarty. Aber dieses Vorhaben hat nichts damit zu tun, europäisches Gedankengut zu deklassieren, da es ebenso unersetzbar wie unangemessen sei, wenn es darum geht, die Erfahrungen mit der politischen Moderne in nicht-europäischen Gesellschaft erleb- und fassbar zu machen. Unter Berufung auf die indische Gelehrte Leela Gandhi erklärt er, dass es nicht als postkoloniale Rache aufgefasst werden dürfe.
Die Intensivierung der Globalisierung mit den einhergehenden Standortverlagerungen, die Machtzunahme Chinas wie überhaupt Asiens, die Umwelt- und Flüchtlingskrisen, die Zunahme der
Wahrscheinlichkeit von Pandemien und globalen Krankheitswellen haben große Teile der französischen Bevölkerung traumatisiert, erklärt der Historiker Pierre Singaravelou, Professor am King’s
College in London und an der Universität Paris I Panthéon-Sorbonne. „Angesichts dieser angsteinflößenden Herausforderungen, inszenieren Eric Zemmour oder andere reaktionäre Intellektuelle
Frankreich wie eine einsame Insel, die vom Rest der Welt losgelöst sei. Ein Land, das seit den Zeiten Chlodwigs I (ca. 466–511 n. Chr.) bis in die Gegenwart gleich geblieben sein soll“, so
Singaravelou weiter. Mit ein Grund, warum dem Buch „Eine Weltgeschichte Frankreichs“, ein Gemeinschaftswerk zusammen mit Patrick Boucheron, Professor am Collège de France, nicht nur der Vorwurf
gemacht wird, der französischen Nationalgeschichte geschadet zu haben, sondern zugleich „die französische Nation zu zersetzen. Frankreich ist alles andere als ein geschichtliches Faktum, dessen
Geschichte immer schon im Voraus verfasst würde“, erklärt Pierre Singaravelou. Seit Jahrhunderten wird dessen Bevölkerung durch stetige Vermischung gebildet, wie es schon seit den 1950er Jahren
Historiker wie Lucien Febvre und François Crouzet in ihrem Buch „Wir sind Mischlinge“ (Nous sommes des sang-mêlés) konstatieren. Auch die Grenzen Frankreichs haben sich immer wieder verschoben,
und sogar das Französische hat sich innerhalb der Landesgrenzen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts endgültig durchgesetzt. Heißt: Frankreich ist keine unveränderbare Tatsache und die
Rolle der Historiker muss es sein, den Lauf der Geschichte eines Landes, das im Austausch mit der Welt immer wieder neu entsteht, nicht als etwas Unveränderbares und Schicksalhaftes zu
beschreiben.
Diese drei Veränderungen können zum Teil helfen, die Gründe für das Reaktionäre in der Gesellschaft zu verstehen. Oder zumindest herausarbeiten, dass die intellektualisierten Querelen rund um den
Begriff Intersektionalität vielleicht nicht wären ohne das Verständnis eines Generationenkonflikts, der bis in die
Universitäten und hinein in die Gruppe der Forschenden reicht, so jedenfalls die Auffassung des Philosophen Claude Gautier und der Historikerin Michelle Zancarine-Fournel. „Was feststeht ist,
dass dieser Dreiklang aus Umweltschutz, Feminismus und Postkolonialismus die Jugend mobilisiert, die sich politisch an diesen Fragen sozialisiert und bildet, wie es die Bewegungen „Fridays for
future“, „#metoo“ oder „Black Lives matters“ gezeigt haben“, so der Historiker Pap Ndiaye, Generaldirektor des Palais de la Porte-Dorée (Immigrations- und Kolonialmuseum) und des Museums der Einwanderungsgeschichte.
Der Historiker der Geschichte der Vereinigten Staaten und der Lebensbedingungen der schwarzen Bevölkerung zeigt sich verblüfft vom ausgeprägten Antiamerikanismus der Neoreaktionären, die seine
Arbeiten und Mobilisierungen als importierte Ideologie betrachten. Beginnend mit der Geographin Elisée Reclus und den Philosophen André Gorz in Bezug auf die Ökologie; weiter mit der Philosophin
Simone de Beauvoir und der Schriftstellerin Françoise d’Eaubonne in Bezug auf den Feminismus; und schließlich noch die Dichterin Aimé Césaire sowie der Psychiater Frantz Fanon in Sachen
Dekolonisierung – Frankreich führt seit Langem diese und ähnliche Debatten. „Es gibt tatsächlich eine Reaktion auf eine Reihe tiefgreifender Reformen der Gesellschaft, die Widerstände innerhalb
konservativer Bevölkerungsschichten provozieren – zum Beispiel die Ehe für alle oder der Kampf gegen Sexismus“, erklärt der Anthropologe Didier Fassin, Herausgeber des Buches „La societé qui
vient“. Eine Reaktion, „die oft Formen panischer Moralvorstellungen annimmt, als ob die traditionelle Welt mit all ihren Werten dem Untergang geweiht sei.“ Gleichwohl werden immer wieder neue
Sündenböcke kreiert, seien es Moslems, Flüchtlinge und selbst solche, die selber Opfer solcher Diskriminierung seien und als Islam-Linke oder als Komplizen des Terrorismus beschuldigt werden, die
dann aber genau diese Anprangerungen für sich instrumentalisieren, um die Gesellschaft zu spalten.
Der Wunsch nach Ablenkung
Die befragten Intellektuellen geben sich weder friedlebend noch versöhnlich. Manche gestehen ein, in gewisser Weise „vom Weg abgekommen zu sein“, besonders jene, die einem militanten Aktionismus
anhängen, bei dem es ums nackte Überleben und um die kulturelle Identität indigener Völker zu gehen scheint. Aber wie schon der bekannte Soziologe Edgar Morin sagte: „Anstatt in Angst und
Schrecken vor einer planetarischen Katastrophe zu leben, die uns alle heimsuchen wird, sind wir wegen einer „Woke“-Bewegung in Schockstarre, die nur eine Minderheit in Frankreich darstellt.“
Offenbar ein verkappter Wunsch nach Ablenkung. Die neoreaktionäre Strategie scheint darin zu bestehen, das Augenmerk auf einige wenige Dinge zu richten, um insgesamt eine wichtige intellektuelle
Bewegung in Misskredit zu bringen. Die kulturelle Hegemonie, eine Idee, die im Wesentlichen durch den kommunistischen Philosophen Antonio Gramsci (1891–1937) geprägt wurde und die aussagt, dass
der politische Kampf über einen ideologischen Krieg zu führen sei, ist vom Lager der Linken in das der Rechten gewandert, sagt Didier Fassin. „Wir haben die Medienschlacht verloren“, gesteht
Pierre Singaravélou ein. Die Bewusstwerdung ist vielleicht zu spät eingetreten, aber die Gegenbewegung ist dabei, sich zu organisieren.
Das zeigen beispielsweise auch die Beiträge der Historiker Laurent Joly und Laure Murat. Ersterer demontiert die historischen Lügen eines Eric Zemmour und macht die Gefahren seines ethnischen
Nationalismus öffentlich. Letztere macht sich dafür stark, dass die „Woke“-Ideologie und insbesondere das was in neokonservativen Kreisen unter „cancel culture“ verstanden wird – trotz der
Tatsache, dass sie durchaus mit Makeln behaftet sind – sich nicht auf eine fanatisierte Bewegung von Denkmalschändern oder auf eine Diktatur von Minderheiten reduzieren lassen. Sondern dass sie
vor allem, wie es die Schauspielerin Jodie Foster so treffend formulierte, besser spät als nie zum Himmel schreiende Ungerechtigkeiten reparieren.
Die gesellschaftlichen Gräben sind unverändert da. So auch nach dem Sieg von Donald Trump, als eine Gruppe progressiver Intellektueller die Meinung äußerte, dass die Linke das Soziale
vernachlässigt und dem Gesellschaftlichen das Feld überlassen und sich mehr den Minderheiten und weniger den Arbeitenden zugewandt habe. Und folglich auch den Diskurs der reaktionären Kräften
befeuere. „Der Zusammenbruch der Arbeiterbewegung, die tiefe Enttäuschung der unteren gesellschaftlichen Schichten im Hinblick auf eine Linke, die selbst in Zeiten der
Regierungsverantwortung ihren Erwartungen ins keinster Weise gerecht wurde: all dies hat dazu beigetragen, die wirtschaftlichen und sozialen Fragen zu verdrängen“, analysieren die Autoren Gérard
Noriel und Stéphane Beaud. Ein Teil der Linken hat sich dem Diskurs der Rechten angeschlossen, dass die religiöse Neutralität des Staates in Gefahr sei. Ein anderer hat sich das aus den
Vereinigten Staaten übernommene Narrativ des „systemischen Rassismus“ und der „weißen Privilegien“ zu Eigen gemacht. Die Vielfalt der Bewegungen und Initiativen, die sich für oftmals gute und
richtige Ziele einsetzen, ohne aber willens oder fähig zu sein, diese Ziele in ein kohärentes Gesamtziel zu integrieren, tragen ebenfalls zum gegenwärtigen Zusammenbruch der Linken bei.
Soziologisch betrachtet, lässt es sich erklären durch die nahezu völlige Abwesenheit von Meinungsführern, die unmittelbar aus dem Milieu der Arbeitenden und kleinen Angestellten stammen. Und
darum fühlen sich viele auch gar nicht mehr angesprochen von den sterilen Polemiken, oftmals auf einem wirklich beschämenden Niveau, die auch immer wieder den Weg in die Schlagzeilen
finden.
Eva Illouz unterstreicht ihrerseits die enorme Vitalität der feministischen, Trans- und postkolonialen Bewegungen, merkt aber auch an, dass diese sich schneller und weiter als die Bevölkerung
entwickeln und deshalb die Kluft, die sich zwischen beiden immer weiter auftut, mehr und mehr zu Spannungen und Ablehnungen führt. Zumal diese Bewegungen mittlerweile „von sozialen Gruppen
angeführt werden, die von einem Großteil der Bevölkerung sowohl geographisch entfernt als auch sozial entfremdet sind“, so Illouz. „Der Gegensatz zwischen Klassen- und Rassen-Verhältnisse ist
nichts als eine oberflächliche Unterscheidung“, erläutert Pap Ndiaye. „Der Kampf gegen Diskriminierungen, unter denen jene zu leiden haben, die aufgrund ihrer mutmaßlichen Herkunft keine Arbeit
finden können und sich somit niemals wirklich in die Gesellschaft werden integrieren können, ist ganz offensichtlich ein sozialer Kampf. Deshalb hängen die spezifischen Probleme von Menschen, die
rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind, unmittelbar mit dem Allgemeinwohl zusammen. „Die Meinungsführer der Linken sind derzeit nicht in der Lage, einen Damm gegen die reaktionäre
Hegemonie zu errichten“, bedauert Frédérique Matonti. Damit die fortschrittlichen Kräfte das ideologische Fundament neu errichten können, muss endlich Schluss sein mit den durch Kontroversen
hervorgerufenen falschen Gegensätzen: es muss Schluss sein, Feminismus und Neofeminismus sowie universeller und intersektionaler Antirassismus einander vermeintlich unversöhnlich
gegenüberzustellen. Und es muss Schluss sein, den Kampf gegen Diskriminierung und den Kampf gegen Ungleichheit, die Verteidigung der Arbeiterklasse und die Verteidigung von Minderheiten
gegeneinander auszuspielen.
Die Feststellung einer ausgeprägten reaktionären Stimmung wird begleitet von dem Gefühl, um nicht zu sagen der Überzeugung, eine Zeit enormer Veränderungen zu erleben, die von vielen Zeitgenossen
getragen und unterstützt wird, die – wie es der Dichter Apollinaire einst ausdrückte – „müde sind von dieser alten Welt“. „Ja, eine neue Welt ist dabei zu entstehen“, jubelt Pap Ndiaye, „selbst
wenn die Polemiken, die von den Reaktionären stammen, das Klima vergiften.“ Der Philosoph Antonio Gramsci, intellektueller Kommunist, der von jenen vereinnahmt wird, die seit den 1980er Jahren
die Theorie eines „Gramscismus von rechts“ errichten wollen, schrieb einst, dass die Krise genau darin bestehe, dass
das Alte vergehe, ohne dass etwas Neues entstehen kann – selbst wenn sich in dieser Zwischenphase vielfältigste Verfallserscheinungen beobachten lassen. Eine gute Gelegenheit, so der Autor, den
pessimistischen Verstand mit einem optimistischen Willen zu verbinden.
Originalartikel „Ces idéologies néoréactionnaires qui refusent les bouleversements du monde" erschienen am 15. Januar 2022 in der Printausgabe der Le Monde. Verfasser: Nicolas Truong. Erweiterte Übersetzung.
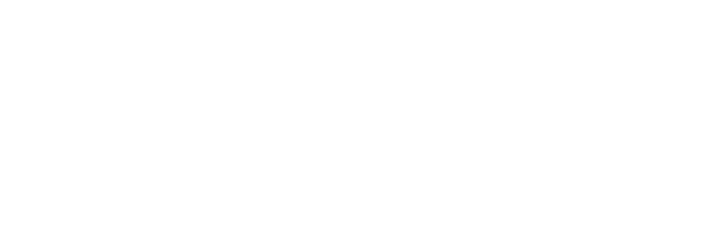
Kommentar schreiben