
Edgar Morin (*1921) ist mit seinen fast 100 Jahren einer der größten noch lebenden Soziologen und Philosophen Frankreichs und darüber hinaus vor allem in der Hispanophonie, also in Spanien und Lateinamerika, bekannt. Der Grad seiner Bekanntheit schlägt sich nicht zuletzt in zahllosen Ehrendoktorwürden nieder, die ihm in diesen und vielen weiteren Ländern verliehen wurden, während er im deutschsprachigen Raum keine vergleichbare Rezeption erfahren hat. Als langjähriger Freund Stéphane Hessels, verband beide Intellektuelle die Sorge um die Zukunft unserer Welt, ja der Menschheit als Gattung, die exemplarisch Ausdruck in der Veröffentlichung des gemeinsamen Manifestes „Wege der Hoffnung“ (2012) fand – einem Buch, in dem sie angesichts von Umweltzerstörung, Gewalt, Sinnentleerung und rücksichtslosem Gewinnstreben Ideen für eine bessere Welt entwickelten.
Bekannt wurde Morin in erster Linie durch sein opus magnum „La méthode“ (Ausschnitt als PDF), einem Werk in sechs Bänden, in dem er sich dem Begriff der „Komplexität“ auf unterschiedliche Weise nähert. Das Werk ist als „eine Art Summa des wissenschaftlichen Wissens konzipiert, die von den Naturwissenschaften ausgeht und bis in die humanen bzw. Geisteswissenschaften reicht“ (Giancarlo Corsi: Die Einheit als Unterschied, 2016). Als emeritierter Forschungsdirektor des CNRS (Centre national de la recherche scientifique – Nationales Forschungszentrum) mit aktuell 38 Ehrendoktortiteln überhäuft, bezieht Morin auch in seinem aktuellen Buch „Changeons de voie. Les leçons du coronavirus“ unermüdlich Stellung zu den Herausforderungen unserer Zeit und möchte Ideen liefern „für die Zeit danach“.
Im Frankreich des Jahres 2020, fünf Jahre nach den Angriffen auf die Redaktion von Charlie Hebdo und die Ermordung dutzender Menschen im Bataclan, werden noch immer Menschen im Namen Gottes getötet. Sind die Hinrichtung des französischen Lehrers Samuel Paty oder der islamistische Terroranschlag von Nizza ein Zeichen davon, dass sich Geschichte doch wiederholt?
Zunächst einmal möchte ich mich vor der Betrachtung dieser tragischen Ereignisse positionieren und klarzustellen, von wo aus der Autor dieses Interviews spricht. Was die Religionen anbelangt, so denke ich, dass der menschliche Geist seine Götter selbst erschaffen hat, um sie zu verehren und sich ihnen zu unterwerfen. Ich selbst bin, wie man so schön sagt, Agnostiker. Soll heißen: Ich glaube daran, dass unser Universum seinem Wesen nach ein Mysterium ist, das sich der menschlichen Erkenntnis entzieht. Für mich ist die Bibel als Fundament der drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam Stoff für Mythen und Legenden. Ebenso halb Legende, halb geschichtliche Wahrheit sind die Evangelien und der Koran. Dennoch bewundere ich Jesus, ohne dass ich an seine Auferstehung glaube.
Wenn Religionen sich allmächtig gebaren, wie heutzutage im Iran oder in Saudi-Arabien, dann hasse ich ihren Hass auf alle Gottlosen, alle Andersgläubigen und Nicht-Gläubigen, wie ich auch ihre Verbote und Beschränkungen hasse, die sie vor allem Frauen auferlegen. Im Judentum der Vergangenheit war dies beispielsweise der Fall, so wie es heute noch bei den Orthodoxen gelebt wird. Auch im Christentum war es über Jahrhunderte so gewesen, in vielen Ländern des Islams ebenso. Übrigens werfe ich Islam und Dschihadismus nicht in einen Topf. Zwischen einem frommen Moslem und einem fanatischen Mörder oder zwischen Franz von Assisi und dem Großinquisitor Torquemada liegen Welten. Mit dem Begriff „Islamismus“ werden diese Unterschiede verschleiert, um damit der Anwerbung und Konvertierung Andersgläubiger zum Islam, der Ablehnung der Demokratie und der Trennung von Staat und Religion einen Namen zu geben. Es ist klar, dass die Scharia mit den Gesetzen einer Demokratie inkompatibel ist. Die Mehrheit der Moslems in Frankreich respektieren Recht und Gesetz unseres Landes und sie sind nicht zuletzt deswegen friedliebend, als sie aufrichtig davon überzeugt sind, dass ihre Religion eine Religion des Friedens ist. Den Franzosen erscheint der Islam jedoch als eine fremde Religion – was diese aufgrund ihres Ursprungs und der arabischen Liturgiesprache sicherlich ist. Gleichzeitig ist sie jedoch eine ganz und gar christlich-jüdische Religion, die sich auf biblische Erzählungen gründet und Jesus als Propheten integriert.
Ich verabscheue jeden mörderischen Fanatismus zutiefst, wie derjenige, der schon im 20. Jahrhundert sein Unwesen getrieben hat und der in traditionelle religiöse Formen gekleidet wieder erstarkt. Ich finde es schön, mit Gläubigen Gespräche zu führen, weshalb ich es nicht in Ordnung finde, sie zu diskreditieren. Weder zu beleidigen noch zu demütigen, ist meine ethische Überzeugung, die universelle Gültigkeit hat. Respekt für mein Gegenüber zu haben, ist eine Haltung, die von mir verlangt, nicht lächerlich zu machen, was dem anderen heilig ist. Nichtsdestotrotz nehme ich mir die Freiheit, die Überzeugungen des anderen kritisch zu hinterfragen. Die Achtung vor der Freiheit bedeutet auch, meine Redefreiheit zu respektieren. Ich habe zutiefst empfunden, wie schmerzhaft es für die unterworfenen indigenen Völker Nord- und Südamerikas war, dass ihre heiligen Stätten durch europäische Eroberer und Siedler entweiht wurden. Und wenn eine allmächtige und omnipräsente Religion die nicht vollkommende oder gar verweigerte Unterwerfung unter ihre Riten als Blasphemie bestraft – so geschehen mit der Hinrichtung des Chevalier de la Barre, der sich geweigert hatte, während einer Fronleichnamsprozession seinen Hut zu ziehen, oder angesichts der von iranischen Ajatollahs ausgesprochenen Fatwa gegen Salman Rushdie –, fühle ich mit den Verurteilten.
Das ist mit ein Grund für mein augenscheinlich widersprüchliches Verhalten: Ich bin für das Recht der Frauen, die sich im Iran verschleiern, und auch für das Recht derjenigen Frauen, die sich in Frankreich verschleiern. Das ist meine Haltung: weder Islamist noch radikaler Linker, sondern ein Anhänger Montaignes und Spinozas. Außerdem würde ich mir wünschen, dass wir den Sachverhalt in seiner ganzen Komplexität betrachten, was jedoch nicht bedeutet, den mörderischen Fanatismus islamistischer Dschihadisten zu verharmlosen.
Was halten Sie von der Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen und ihrer Inanspruchnahme zu erzieherischen, politischen oder ideologischen Zwecken?
Denken wir einmal kurz zurück: Die Mohammed-Karikaturen sind nicht französischen, sondern dänischen Ursprungs. In ihnen wird ein Zusammenhang mit dem von gläubigen Moslems verehrten Propheten und heutigen dschihadistischen Terroristen hergestellt, was gelinde gesagt fragwürdig ist. Sie wurden übrigens nicht in liberalen Ländern wie Großbritannien oder den Vereinigten Staaten nachgedruckt, und auch nicht in Italien oder Spanien, in denen die Verächtlichmachung von Religionen unter Strafe stehen.
Die Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen ist in Frankreich erlaubt, auch wenn es für gläubige Moslems einer Gotteslästerung gleichkommt, da dieses Recht zu unseren Freiheiten gehört. Charlie Hebdo ist nicht bloß die Fortsetzung, sondern der Verstärker einer antiklerikalen und libertären französischen Tradition, die „angemessen“ war, als die Kirche noch einen starken Einfluss auf unser Land hatte. Diese Haltung gegenüber dem Christentum schwächte sich ab, als die Kirche die Trennung von Staat und Religion akzeptierte, so dass sie heutzutage mehr oder minder überlebt ist. Die satirische Wochenzeitung hat die Karikaturen 2006 nachgedruckt und bekam dafür Zustimmung wie auch Kritik – darunter eine Klage muslimischer Vereine, die jedoch 2007 rechtskräftig abgewiesen wurde. 2011 wurde auf die Räumlichkeiten von Charlie Hebdo ein Brandanschlag verübt, der jedoch in Vergessenheit geriet. Die Attentate von 2015 änderten auf einen Schlag die Bedeutung der Wochenzeitung und der Karikaturen: Charlie ist nicht mehr nur ein satirisches Blatt, sondern wurde zu einem Symbol der Meinungsfreiheit. Und die ermordeten Journalisten wurden zu Recht zu Märtyrern der Freiheit, während die Karikaturen wiederum zu einem Teil des französischen Nationalerbes wurden.
Dann, anlässlich der Prozesse gegen die Täter von Charlie Hebdo, entschied sich die Wochenzeitung, die Karikaturen erneut zu veröffentlichen. Diese erneute Veröffentlichung wurde als Inbegriff des französischen Freiheitsgedankens und ihre Verbreitung als angemessene Verteidigung des kritischen Geistes gesehen. Der Geschichtslehrer Samuel Paty, ein Mann der Freiheit, war davon überzeugt, dass sie für das kritische Denken seiner Schüler förderlich sein können. Anfänglich verursachte es nur wenig Aufsehen, abgesehen von der Anzeige eines muslimischen Vaters und der offenbar erfolgreichen Beschwichtigung seitens der Schuldirektorin. Aber als ein Imam Öl ins Feuer goss und die Sache erneut aufheizte, brachte er mutmaßlich einen jungen Tschetschenen dazu, den Lehrer zu enthaupten. Diese Ermordung hat die Lehrerschaft dieses Landes und die Gesellschaft als Ganze in enorme Aufregung versetzt und eine Welle von wüsten Schmähungen gegen die vermeintlich „staatliche Laschheit“ oder Nachsicht seitens des Islams oder der Linken losgetreten. Emmanuel Macron hat das Grundrecht auf Freiheit verteidigt und das Versprechen abgegeben, so die Version der Medienvertreter, dass Frankreich die Karikaturen verteidigen wird – als würde es sich um eine nationale Verantwortung handeln. Diese Äußerungen wurden jedoch vom Präsidenten dementiert und in einem Interview mit dem arabischen Fernsehsender Al Dschasira abgeschwächt, als er eingestand, dass diese Karikaturen schockierend sein können.
Nach dem Schock über die Attentate wurde die Kritik lauter, dass die dänischen Karikaturen immer mehr zu einem Symbol der französischen Identität würden. Ist das gerechtfertigt?
Der Schrecken über die Enthauptung des Lehrers und die Attentate von Charlie Hebdo hat aufgrund der Ereignisse, der Grausamkeit und des offensichtlichen Wahnsinns der Taten einen Teil der Wirklichkeit ausgeblendet, woher er denn stammt. Der Schrecken hemmt jeden Versuch, darüber nachzudenken oder das Geschehene einzuordnen, als ob Einsicht oder Verständnis als eine Art von Rechtfertigung der Taten missverstanden werden können. Man darf nicht außer Acht lassen, dass solche Karikaturen gläubige Moslems zutiefst schockieren. Schlimmer noch, sie sind der Grund für furchtbare Gräueltaten. Schließlich hat ihr Bekanntwerden zahllose und heftigste antifranzösische Proteste in der islamischen Welt provoziert. Es gibt gewiss Fälle, in denen man das Unverständnis, das einem aus dem Ausland entgegenschlägt, aushalten muss. Aber es gibt gleichwohl Fälle, wo es angebracht erscheint, solche Reaktionen nicht zu provozieren, besonders in Zeiten globaler Unsicherheiten.
Man muss angesichts der furchtbaren Auswirkungen von Taten, die aus „besten Absichten“ geschehen, vorsichtig sein. Manchmal gibt es einen Widerspruch zwischen Freiheit und Verantwortung für das, was man sagt oder schreibt. Hier geht es um einen genau solchen Fall und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass jede Wahl auch mit einem Risiko behaftet ist. Gelegentlich treffen Verantwortung und Verantwortungslosigkeit aufeinander, weshalb ich es unverantwortlich finde, die permanente Verbreitung dänischer Karikaturen als „wahre“ französische Freiheit zu betrachten. In Band 5 meiner Arbeit „La méthode“ habe ich dargelegt, dass sich Ethik nicht nur auf gute Absichten beschränken darf. Sie muss auch ein Gespür für die Konsequenzen ihrer Taten haben, die oftmals im Widerspruch zu ihren Absichten stehen. Vor allem: Jede Entscheidung, die in einer unsicheren oder konfliktbehafteten Situation getroffen wird, trägt das Risiko gegensätzlicher Effekte in sich. Die Karikaturen dürfen nicht aufgrund der libertären oder freiheitsliebenden Absichten ihrer Urheber und Verbreiter beurteilt werden, sondern auch im Hinblick auf die Möglichkeit schädlicher oder desaströser Folgen. Meinungsfreiheit kann nicht gänzlich verhindern, dass es zu Missverständnissen, Unverständnis, gewalttätige oder kriminelle Folgen kommt. Können die Karikaturen Fromme und Gläubige dazu bringen, ihren Glauben in Zweifel zu ziehen? In keinster Weise. Tragen sie dazu bei, den Dschihadismus zu schwächen. Ebenfalls nein.
Originalartikel „Que serait un esprit critique incapable d’autocritique“ erschienen am 21. November 2020 in der Printausgabe der Le Monde. Verfasser: Nicolas Truong. Erweiterte Übersetzung.
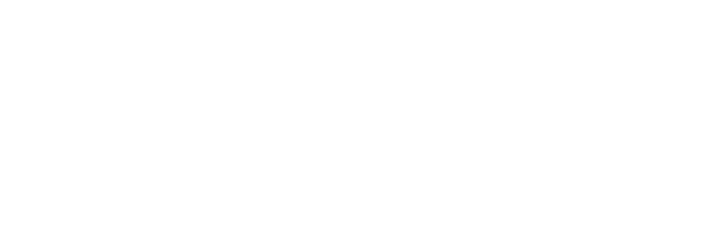
Kommentar schreiben