Vor langer langer Zeit, also mindestens vor dem Bologna-Prozess oder den ersten PISA-Studien, galt Bildung, gebildet sein etwas in Deutschland. Es gab ein Bildungsbürgertum mit Bildungsbedürfnissen, die in noch nicht ganz so zahlreich vorhandenen Bildungsanstalten befriedigt wurden. Das Wort „Bildung“, sprachhistorisch betrachtet, erlebte im Laufe des 18. Jahrhunderts, mithin zu Zeiten der Aufklärung, eine nachgerade inflationäre Verwendung im Vergleich zu den vorangegangenen Epochen. Erst im Zeitalter der Industrielle Revolution, als der Bedarf an Handarbeitern und Handlangern zunahm, wurde der Begriff „Bildung“ weniger in den zahlreich erschienenen Druckerzeugnissen verwendet. Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Worthäufigkeit dieses Begriffs den Höhepunkt erreicht und fiel danach ab.
Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts blieb hingegen die Worthäufigkeit des Begriffs „Bildung“ laut Referenzkorpus des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache (einer gigantischen Wortdatenbank), auf mehr oder minder gleichbleibend niedrigerem Niveau. Vielleicht ein Beleg dafür, dass im sogenannten „Goethezeitalter“, also ganz grob dem Jahrhundert zwischen 1750 und 1850, die Beschäftigung von Staat und gebildeter Gesellschaft mit der Idee einer "Bildung" ein größerer Raum einnahm und diese Haltung dadurch auch sprachlich fassbar wurde (wobei natürlich am Ende der Augenschein auch trügen kann und andere Gründe für die schwankende Häufung des Begriffs im Verlaufe der letzten 200 Jahre verantwortlich sein können).
Das hohe Gut der Bildung hat in Zeiten schwindender Rohstoffe, dem Verschwinden von ineffizienten Wirtschaftssektoren und Aufkommen von High-Tech-Industrien sowie einer wachsenden Anzahl von Menschen auf der Suche nach Erwerbsarbeit vulgo Sinn des Lebens – nicht zuletzt in den Industriestaaten – mehr denn je Konjunktur. Gab es nach dem Zweiten Weltkrieg gerade einmal 100.000 Studierende in der alten BRD, büffeln heute rund 3 Millionen deutschlandweit für einen Bachelor oder Master. Bei der Vergabe von Doktortiteln sieht es ähnlich aus: Gab es um 1900 etwas mehr als 1000 Träger eines Doktortitels, hat sich deren Zahl 120 Jahre später um über 2000 % erhöht (PDF Seite 66). Wir dürfen festhalten: Wir haben es in Deutschland mit einer durchaus hoch gebildeten Gesellschaft zu tun.
Wie kann es dennoch sein, dass auch – oder gerade? – der gebildete Teil der Bundesbevölkerung sich nicht entblödet, den krudesten Behauptungen beispielsweise rund um die Corona-Pandemie Glauben schenkt und deren Verbreitung sogar noch aktiv fördert? Es gibt KEINE Behauptung, die zu absurd ist, um nicht auch von gut situierten, gut gebildeten Menschen geglaubt zu werden. Willkommen im Jahre 2020 nach Christus. Wir leben vielleicht in einem Zeitalter, in dem wir nachprüfbarer als je zuvor in der Lage sind, zwischen Gut und Böse, richtig und falsch zu unterscheiden. Und in dem es zumindest in liberalen Demokratien Konsens ist, offen Unsicherheiten, Zweifel oder Nichtwissen einzugestehen und zwar aus der EINSICHT heraus, dass Offenheit und Transparenz immer noch die beste Waffe sind im Kampf gegen Demagogen, Fälscher und Hetzer. Selbst auf die Gefahr hin, dass es die eigene Position, die eigene Glaubwürdigkeit unterminiert. Das sollten wir uns einmal vergegenwärtigen: Es ist ein Beweis für die charakterliche Größe eines Menschen und die Reife einer Demokratie, wenn sich Menschen, die von der Politik oder den Medien als Koryphäen ihres Faches inszeniert werden, an deren Lippen Weltpolitik und Aktienmärkte hängen, dass diese Menschen sich ihrer Verantwortung bewusst sind und darum in ihrem Auftreten dezent, in ihren Äußerungen abwägend und in der von ihnen eingeforderten Gewissheit immer leise Zweifel einflechten.
So wenig es absolute Wahrheiten gibt, so wenig unumstößlich ist das Wissen von sogenannten Experten, die uns mit Informationen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Gesellschaft versorgen. Die Erkenntnis, das dies so ist, immer so war und immer so sein wird, sollte auf beiden Seiten vorhanden sein: bei denjenigen, die Erkenntnisse sammeln, und denjenigen, für die diese Erkenntnisse bestimmt sind. Es ist darum unredlich, wenn sich Teile der Gesellschaft in der Öffentlichkeit oder im Privaten abschätzig über „Experten“ äußern, die ihrer Meinung nach unfähig, unglaubwürdig, unstet in ihrer Haltung seien. Wer heute das Faktum in die Welt setzt, dass die Reproduktionszahl R oder die Anzahl der Neuinfektionen der am meisten Erkenntnis fördernde Wert zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sei, morgen sich aber vor eine Weltöffentlichkeit hinstellen muss, um diese Aussage zu relativieren oder korrigieren, gehört mit Respekt behandelt und nicht mit Schimpf und Schande übergossen.
Bildung, um den Bogen zurück zum eingangs Gesagten zu spannen, sollte eigentlich ein Garant für die Entwicklung von Einsichtsfähigkeit, Selbsterkenntnis und kritischem Urteilsvermögen sein. Diese Überzeugung, das zeigt nicht zuletzt der enorme Zulauf und mediale Widerhall von Verschwörungstheorien und gesellschaftlicher Randgruppen – von linksesoterischen Impfgegnern bis zu rechtsdrehenden Reichsbürger –, dürfen wir uns getrost von der Backe schmieren. Denn es sind gleichermaßen Gebildete wie weniger Gebildete, die bei Mahnwachen mitmaschieren, um zu verhindern, dass Bill Gates weltweit mittels Massenzwangsimpfungen Mikrochips in die Menschen pflanzt, um wirtschaftlich und politisch davon zu profitieren. Oder die Angela Merkel wahlweise für Hitlers Tochter oder eine mächtige Strippenzieherin auf den Bilderberg-Konferenzen halten, die sich für die Durchsetzung einer Weltdiktatur einsetzt. Oder die glauben, dass die Virus-Pandemie ein gigantischer Betrug an der Weltbevölkerung sei, während in Wahrheit das Ziel verfolgt wird, möglichst viele Menschen zu töten, um dem verbliebenen Rest die Freiheits- und Bürgerrechte zu stehlen.
An all das wird ernsthaft und inbrünstig geglaubt. Zu den Anhängern von Wahn machenden Mahnwachen gehören Sänger und Rapper, Schauspieler und Promiköche genauso wie ehemalige Nachrichtensprecher, TV-Journalisten oder politische Mandatsträger. Es sind Menschen darunter, die über Jahre medienpräsent sind und eine zum Teil hohe Glaubwürdigkeit, ja Reputation genießen. Der Schaden für deren Glaubwürdigkeit ist am Ende immens, gesellschaftlich sind sie eskamotiert. Aber auch Medien und Zivilgesellschaft erleiden einen Schaden, weil Anhänger und Follower in einigen (vielen?) Fällen nicht mehr wissen, wem sie noch Glauben schenken sollen und im Zweifelsfall denen am meisten vertrauen, die am lautesten „Glaube mir! schreien. Am Ende reift die Erkenntnis bei den Feinen und die Häme bei den Groben: Bildung schützt vor Blödheit nicht.
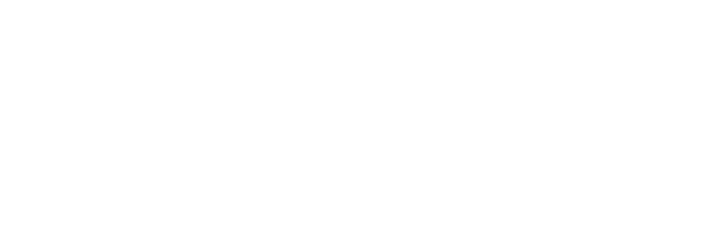
Kommentar schreiben