
Nein heißt Nein? Als die Gesetzgebung das Alter festlegte, unterhalb dessen der Geschlechtsakt zwischen einem Minderjährigen und einem Erwachsenen strafrechtlich als Vergewaltigung behandelt wird, wurde damit zugleich zum Ausdruck gebracht, dass ein Kind nicht das Vermögen besitzt, einem solchen Akt zuzustimmen. Eine Aussage von ungeahnter Tragweite, liegt ihr doch ein außerordentlicher Mentalitätswandel der zurückliegenden zwei Jahrhunderte zugrunde.
Fotos von niedlichen und vertrauensseligen kleinen Mädchen, manche spielen im Garten der Eltern, pusten Seifenblasen in die Luft, andere schlummern süß mit ihrem Stofftier im Arm in ihrem kleinen Bett. Die sozialen Medien sind voll davon und stammen nicht selten aus den digitalen Bildarchiven von Vätern oder Müttern, die diese Fotos ahnungslos dem Netz anvertrauen. Einige prominente Köpfe, Frauen zumeist, aus dem Kulturleben und den Medien haben ihre eigenen Fotos aus jenen Kindertagen beigesteuert und zugleich die Frage aufgeworfen: „Hatte ich damals schon den Willen, Ja zu sagen zu einer sexuellen Beziehung?!“ Für manche eine Möglichkeit, ihrer Überzeugung Ausdruck zu verleihen, die sich auch in Großbuchstaben auf den Plakaten des feministischen Kollektivs #NousToutes wiederfindet: „Ein Kind willigt niemals freiwillig in sexuelle Akte mit einem Erwachsenen ein. NIEMALS.“
Die französische Regierung ist gegenwärtig auf dem
Weg, dieses Glaubensbekenntnis in das französische Rechtssystem zu übertragen. Im Namen des Kindeswohls wird die Gesetzgebung
zukünftig ein Alter definieren, unterhalb dessen jeder geschlechtliche Akt zwischen einem Minderjährigen und einem Volljährigen vom Gesetz automatisch als Vergewaltigung
betrachtet
wird. Die Richter beantworten damit die bislang ambivalente und noch immer kontrovers diskutierte Frage, ob ein Kind in einen Geschlechtsakt eingewilligt habe könne oder nicht. Zukünftig müssen die Gerichte nur noch den Sachverhalt klären, ob der Erwachsene wusste, dass das Kind jünger als 15 Jahren war und sich nicht mehr um die Klärung von Einzelheiten kümmern, ob der Erwachsene Gewalt, Drohung, Zwang oder einen Überraschungsmoment genutzt hat, so wie es die gegenwärtige Rechtsprechung fordert. Die Soziologin Irène Théry hat diesem Prinzip den Namen „altersabhängige Nichteinwilligung“ („non-consentement statuaire“) gegeben. „Indem wir das Gesamtspektrum des Rechts um das absolute Verbot jedweder sexuellen Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem/einer Unter-15-Jährigen ergänzen, erklärt die Gesellschaft im Namen des Schutzes Minderjähriger ausdrücklich, dass diese niemals in einen solchen Akt einwilligen können“, so Théry. „Die altersabhängige Nichteinwilligung muss klar von der situativen Nichteinwilligung unterschieden werden: Letztere betrifft Personen, welche die Fähigkeit zur Einwilligung oder Weigerung zwar besitzen, denen aber eine sexuelle Beziehung zu einer beliebigen anderen Person, egal in welcher Situation, an welchem Ort und unter welchen Umständen auch immer aufgezwungen wurde.“
Indem der Gesetzgeber jedes sexuelle Verhältnis zwischen einem Erwachsenen und einem jungen Heranwachsenden verbietet, definiert er damit zugleich den „geschützten Bereich“, der die Regeln des sexuellen Miteinanders festlegt. Die Grenze zwischen dem Erlaubten und Unerlaubten wird zukünftig am Alter festgemacht. „Das Kind ist in dieser Hinsicht „tabu“ in dem Sinne, als man ihm unterstellt, niemals in eine sexuelle Beziehung einzuwilligen – nicht etwas deswegen, weil es jung und abhängig ist, sondern weil der Schutzraum des Kindseins von der Gesellschaft vor Übergriffen geschützt werden muss“, so Irène Théry, Studienleiterin an der Hochschule für Sozialwissenschaften EHESS. Wenn die Grenzen des Erlaubten und Verboten heutzutage durch den speziellen Blickwinkel der Einwilligung gesehen werden, dann deswegen, weil diese Art der Wahrnehmung ins Zentrum unserer Sexualmoral führt. Antoine Garapon und Denis Salas, die beiden Autoren des Buches „Die neuen Hexen von Salem“ (Nouvelles Sorcieres de Salem, Seuil 2006), behaupten, dass sich Frankreich im Verlaufe der letzten 200 Jahre von einer Gesellschaft gegründet auf die „guten Sitten“ – mit einer Institution Ehe als Rahmen für eine gestattete Sexualität – hin zu einer Gesellschaft der freien Wahl entwickelt habe, in der einzig diejenigen Taten sanktioniert werden, die einen Angriff auf die Würde des Menschen darstellen. In einer Welt voller Wahlverwandtschaften wird die Begierde einzig durch die Freiheit des anderen beschränkt, so die beiden Autoren. Die Einwilligung wird dadurch zu einer regulativen Norm im sexuellen Miteinander.
Dass diese Sichtweise historisch bedingt ist, zeigt der Blick auf die Vergangenheit. Während des Ancient Régime, also die Zeit bis zum Ausbruch der Französischen Revolution, wurde eine Vergewaltigung nicht als eine Verletzung der physischen und psychischen Integrität des Opfers betrachtet, sondern als eine moralische Schandtat, welche die Familienehre des Opfers beschmutzte. Sie wurde gleichgesetzt mit Sünde, Wolllust oder Anstößigkeit, aber nicht mit Gewalt. In der damaligen religiös geprägten Gesellschaft wurden Täter und Opfer gleichermaßen sozial stigmatisiert. Mädchen, die von ihren eigenen Vätern missbraucht wurden, wurden teilweise ins Zuchthaus oder in die Verbannung geschickt, als ob das Vergehen beiden zur Last gelegt werden könne, so George Vigarello in seiner „Geschichte der Vergewaltigung“ (Histoire du viol, XVIe-XXe siecle, Seuil 2000). Man wird tatsächlich bis zur Französischen Revolution warten müssen, bis sich die Sicht auf die Vergewaltigung verändert. 1789 wurde festgelegt, dass jeder Mensch sein eigener Herr sei, und Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), ein französischer Priester und Staatsmann, definiert die ersten Eckpfeiler des Prinzips von der freien Verfügung über sich selbst. Diese sozusagen „Erfindung“ des Individuums, wie die Philosophin Elisabeth Guibert-Sledziewski es nennt, macht aus einem Opfer einen vollwertigen Bürger („un sujet à part entière“) und aus dem Fehlen jedweder Einwilligung in eine solche Handlung ein strafwürdiges Vergehen. Das Strafgesetzbuch von 1791, das für Vergewaltigung sechs Jahre Kettenstrafe vorsah, sah in einer Vergewaltigung erstmals ein Verbrechen und einen Angriff gegen eine Person.
Diese juristische Revolution stellte die religiöse Sichtweise der Vergewaltigung auf den Kopf, die noch aus den Zeiten des Ancien Régime stammte. Im Namen des unveräußerlichen Besitzes von sich selbst („invincible appartenance à soi“), ein Bild geprägt von Georges Vigarello, wird eine Vergewaltigung nicht länger als Sünde, Laster oder moralische Verderbtheit betrachtet, welche die Ehre von Vätern und Ehemännern verletzt. Das Bild wandelt sich im bürgerlichen und demokratischen Strafrecht, das sich im 19. Jahrhundert herausbildet, zu einer psychischen Verletzung und zu einem Angriff auf die Würde. Der Begriff des Bürgers wird künftig von seiner eigenen Person her definiert und nicht aufgrund von Zugehörigkeit oder gar „Besitz“ von jemand anderem, so Vigarello. Diese gesellschaftliche Denkweise verändert sich jedoch nicht innerhalb weniger Jahrzehnte. Trotz seines revolutionären Erbes, bleibt das Frankreich des 19. Jahrhunderts stark von der Idee beeinflusst, dass die Gesetze eher dazu da seien, die soziale Ordnung als Ganze zu schützen als den einzelnen Menschen. „Der Gesetzgeber der napoleonischen Zeit macht aus der vom Familienoberhaupt geführten Familie einen der Eckpfeiler einer sehr hierarchischen Gesellschaft,“ so die Soziologin Mary Romero, Autorin einer Doktorarbeit über den Tatbestand der Einwilligung bei Sexualdelikten verübt an Minderjährigen. „Das Bürgerliche Gesetzbuch von 1804 legte fest, dass niemand von den Gesetzen, die Moral betreffend, abweichen darf, während das Strafgesetzbuch von 1810 dagegen die schlechtes Sitten bestraft.“
Originalartikel „De l'enfant coupable à l'enfant victime, la lente reconnaissance du non-consentement" erschienen am 6. März 2021 in der Printausgabe der Le Monde. Verfasser: Anne Chemin. Erweiterte Übersetzung.
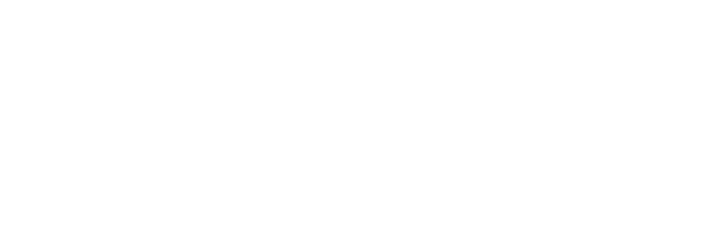
Kommentar schreiben