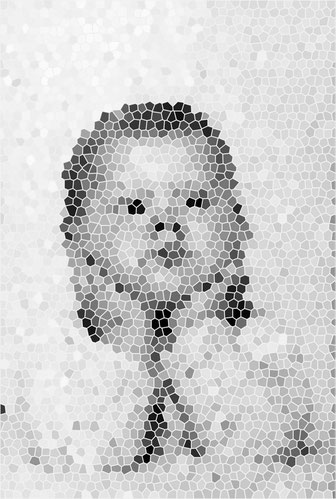
Besorgt um den Schutz des ehelichen Bundes, der Jungfräulichkeit junger Mädchen und der Ehre der Familien, fordert der Code Napoléon bei einer Vergewaltigung, dass dem Opfer physische Gewalt angetan wurde. Aber nur selten findet man Spuren der Gewalt bei Kindern: manche wurden im Namen einer selbsternannten moralischen Autorität terrorisiert oder durch die physische Übermacht des Aggressors; andere wiederum haben gar nicht richtig verstanden, was ihnen zugestoßen ist, und wiederum einigen wurden Repressalien angedroht. Am Beginn des 19. Jahrhunderts wurde ihnen allen vom Gesetz unterstellt, eingewilligt zu haben. Es war die Zeit der Verdrängung und Verweigerung, meint Anne-Claude Ambroise-Rendu, Autorin des Buches „Geschichte der Pädophilie im 19. bis 21. Jh.“ (Histoire de la pédophilie XIX-XXI siècle, Fayard 2014). Die sehr hohe Zahl an Freisprüchen vor Gericht in den Jahren 1810 bis 1820 zeugt von der Schwierigkeit, die Vorstellung einer Nichteinwilligung bei Kindern überhaupt vorstellen zu können. Mehr als ein Drittel aller Angeklagter kamen vor dem Schwurgericht straffrei davon. „Viele Richter und Staatsanwälte empörten sich über diese Freisprüche“, erinnert die Historikerin. „Während des Prozesses mussten sie eingestehen, dass der rechtliche Rahmen des Jahres 1810, der vom Code Napoléon festgelegt wurde, dem Vergehen einer Vergewaltigung Minderjähriger nicht angemessen war: Die Mehrheit aller Übergriffe ließ sich nicht auf körperliche Gewalt zurückführen, die mögliche Spuren auf den Körpern der Kinder hinterlassen hätten, sondern stand in Verbindung mit der Ausübung moralischen Drucks: Manipulationen, Verführungen und Einschüchterungen.“
Um diese „Gewaltausübung auf die Seelen“ ausreichend in Rechnung zu stellen, entschied sich der Gesetzgeber zu Beginn des 19. Jahrhunderts, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. In Bezug auf Sexualdelikte wurde 1832 ein gesetzliches Alter der Nichteinwilligung definiert und im selben Jahr auf 11 Jahre festgelegt, 1863 dann auf 13 und 1945 schließlich auf 15 Jahre. Jedes Kind, das zu einem Erwachsenen eine sexuelle Beziehung hat, ob eine Misshandlung vorlag oder nicht spielte dabei keine Rolle, wurde künftig vom Gesetz her als Opfer behandelt. „Da ein Kind schwach und unerfahren sei“, so ein Mitglied des Chambre des pairs (dem damaligen französischen Oberhauses des Parlaments), kann es niemals einer sexuellen Handlung mit einem Erwachsenen zustimmen, so hieß es fortan per Gesetz. Mit diesem deutlichen Bruch wurde erstmals der Straftatbestand der Pädophilie erschaffen“, resümierte Michel Foucault in seinem Werk „Der Wille zu Wissen“ (La Volonté de savoir, Gallimard 1976). Richter hatten keinerlei Veranlassung mehr, sich mit den jeweiligen Umständen einer Tat wie missdeutigen Gesten, dem Verhalten des Aggressors oder dem Verhalten des minderjährigen Opfers zu befassen: Unterhalb eines bestimmten Alters wird eine Vergewaltigung unterstellt, fasst Justizminister Fèlix Barthe zusammen. Die Frage der Einwilligung seitens des Kindes, auf die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Richter und der Geschworenen gerichtet hat, verschwindet aus dem Rechtsbereich. „Das Alter wird zukünftig zu einem wesentlichen Element bei der Betrachtung einer Straftat“, erläutert die Soziologin Mary Romero. „ Es handelt sich um einen radikalen Wandel im Umgang mit Anschuldigungen.“
Kam diese „neue Vorstellung“, nach einem Wort von Anne-Claude Ambroise-Rendu, vielleicht etwas zu früh? Ist der Ruch der Sünde, der seit dem Ancien Régime der Vergewaltigung anhaftet, noch immer zugegen? Trotz des Gesetzes von 1832 fahren die Richter unentwegt fort, die Einwilligung vonseiten der Opfer in Frage zu stellen. „Im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Vorurteile über das vermeintlich zweideutige oder unmoralische Verhalten eines Kindes weitaus wirkmächtiger als die Vorschriften des Strafgesetzbuches“, so Anne-Claude Ambroise-Rendu. „Während aller Verfahren bestanden die Richter, die Staatsanwälte oder der Präsident des Schwurgerichts auf der Klärung der Frage, ob das Kind eingewilligt habe: Das war eine wahrhafte Obsession.“ Um die Untersuchung bezüglich der moralischen Rechtschaffenheit der Opfer zu beschleunigen, überprüften die Richter der damaligen Zeit, ob diese einen tadellosen Lebenswandel hatten. „Die Persönlichkeit eines Kindes war ein permanentes Diskussionsthema innerhalb des Justizwesens“, so die Historikerin. Falls das junge Mädchen für sein Alter schon zu weit entwickelt war, wurde ihm eine gewisse Mittäterschaft unterstellt und der Verdacht stand dann im Raum, dass es sich freiwillig den sexuellen Handlungen hingegeben habe. Falls es den Tathergang mehr oder minder neutral schilderte, wurde daraus gefolgert, dass es frühere sexuelle Erfahrungen gehabt habe und vermutlich den Täter provoziert haben könne.“
Die Mehrzahl der medizinischen Experten aus dieser Zeit waren der Meinung, dass die Opfer willig waren. „Ende des 19. Jahrhundert erarbeite der Psychiater Léon-Henri Thoinot (1858-1915), Mitglied der medizinischen Akademie, eine verheerende Theorie über „vermeintliche“ Sittlichkeitsverbrechen“, schildert Anne-Claude Ambroise-Rendu. „Manche Kinder wurden von ihren Eltern manipuliert“, so seine These, „andere wiederum hatten sich Geschichten ausgedacht, um einer Bestrafung zu entgehen oder um sich vor Erwachsenen wichtig zu machen. Über Jahrzehnte unterrichtete dieser Professor der Rechtsmedizin ganze Generationen darin, dass die erste Untersuchungsregel bei sexuellen Übergriffen gegenüber Minderjährigen die sei, argwöhnisch zu sein.“ Diese Überzeugung wurde von zahlreichen Fachgelehrten geteilt, darunter der Psychiater Ernest Dupré (1862-1921), der meinte, dass ein Kind ein Geschichtenerzähler sei – so wie man es von Hysterikern, Schwachsinnigen und Geisteskranke her kannte. Und Eugène Gelma (1882-1953) behauptete 1923 in der „Revue Annales de médecine légale“ gar, dass kleine Mädchen von gerade einmal 10 Jahren wissentlich Männer durch ihr Verhalten und durch Blickkontakte verführten. Glücklicherweise würden es Gutachten erlauben, frühreifes sexuellen Verhalten junger Mädchen zu erkennen, um dadurch falsche Beschuldigungen zu entkräften. „Freiheit und Rechtschaffenheit von Bürgern sollten nicht vom verleumderischen Gerede einzelner Kinder abhängig sein“, so seine Schlussfolgerung. Der Grundsatz der altersbezogenen Nichteinwilligung, 1832 feierlich vom Gesetz proklamiert, wurde in der Folge im Alltag durch einen ausgeprägten Argwohn gegenüber den Worten eines Kindes, aber auch durch ein völliges Unverständnis dem Leid gegenüber, das eine Vergewaltigung beim Opfer verursacht, unterminiert. In einer Gesellschaft, die noch stark von einer religiös beeinflussten Moralvorstellung geprägt war, glaubte kaum jemand daran, dass ein sexueller Übergriff einen dauerhaften seelischen Schaden bei einem Kind verursachen konnte. Somit wurde eine Vergewaltigung noch immer als eine Kränkung von Moral und Ehre empfunden und nicht als eine Verletzung der psychischen Integrität eines Individuums.
Originalartikel „De l'enfant coupable à l'enfant victime, la lente reconnaissance du non-consentement" erschienen am 6. März 2021 in der Printausgabe der Le Monde. Verfasser: Anne Chemin. Erweiterte Übersetzung.
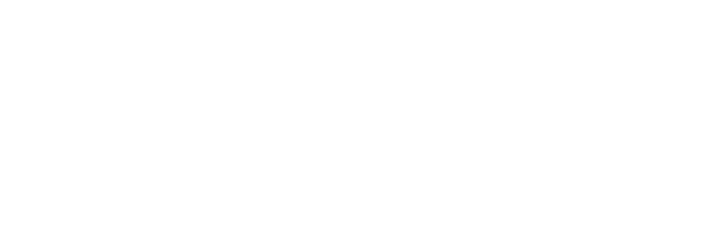
Kommentar schreiben