
Es bedurfte erst einer langen und stillen Revolution des Bewusstsein, dass diese Blindheit ein Ende nahm. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts öffnete der Psychiater Auguste-Ambroise Tardieu (1818-1879) im Pariser Krankenhaus Hôpital Lourcine (heute Hôpital Broca) den Weg, als er sich dem Leid vergewaltigter Mädchen und Kindern zuwandte. Scham, Neurosen, Selbstmord: Der Begründer der rechtsmedizinischen Lehre war der erste, der verstand, dass sexuelle Übergriffe psychisches Leid verursachen. „Eine Vergewaltigung, die mindestens genauso stark die intimsten Gefühle verletzt wie sie den Körper versehrt, führt oftmals zu einer heftigen moralischen Verzweiflung,“ so seine Feststellung. Zunächst mit Skepsis aufgenommen, wurden seine Thesen schließlich zum medizinischen Allgemeinwissen. Ende des 19. Jahrhunderts veränderte die kaum wahrnehmbare, sukzessive Verschiebung des Mitgefühls auch den Blick auf das Kindsein. „Mit der Entwicklung der Psychologie, der Pädagogik und der Psychoanalyse entstand die Vorstellung, dass auch ein Kind, ebenso wie ein erwachsener Mensch, seelisch verletzbar sei, das geschützt werden müsse“, fasst Anne-Claude Ambroise-Rendu zusammen. „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen zudem die liberalen Ideen eines Jean-Jacques Rousseau und des Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) in Mode. Stück für Stück verwandelte sich das Kind von einem Objekt zu einem Subjekt.“
Während frühere Zeiten die Kindheit zu einer „Spielart“, einer frühen Entwicklungsstufe des Erwachsenenalters machten, wurde sie nun als ein einzigartiges und empfindsames eigenes Alters erkannt. Ratgeber zur Kindererziehung, zur Psychologie und Bildung vervielfältigten sich, während sich die Literatur voller Inbrunst auf die Figur des unglücklichen Kindes stürzte. „Die kleine Fadette“ von George Sand und „David Copperfield“ von Charles Dickens entstanden 1849, „Le petit chose“ von Adolphe Daudet 1868, „Sans famille – Heimatlos“ von Hector Malot 1878. Durch all diese Geschichten des Unglücks zieht sich das Bild der Ungerechtigkeit und der Verständnislosigkeit gegenüber den Belangen von Kindern, was dort zum ersten Mal zu Papier gebracht wurde“, stellt der Historiker Georges Vigarello fest. „Der Mentalitätswandel sollte sich auch im Politischen widerspiegeln. „Die französische III. Republik führte 1882 die Unterrichtspflicht für Kinder ein, entwickelte 1889 eine Hilfseinrichtung für misshandelte Kinder und entzog 1898 Familienvätern das Recht, die eigenen Kinder in Besserungsanstalten zu schicken“, so Mary Romero. Diese stringente Entwicklung für das Kindeswohl setzte sich auch im 20. Jahrhundert fort und führte 1912 zur Schaffung eines Rechtswesens speziell für Minderjährige und gipfelte 1945 in einer Verordnung zur Strafmündigkeit von Kindern, in der es hieß, dass es sich Frankreich nicht leisten könne, alles zu unternehmen, um dem Kindeswohl zu dienen.“
Während Frankreich wirtschaftlich auf die „Trente glorieuse“ (die Zeit vom Ende des 2. Weltkriegs bis zu den Ölkrisen in den 1970er Jahren) zusteuerte, wurde das Kindeswohl zu einer nationalen Priorität erhoben. Die Gerichte hatten ihre Rechtsprechung in Sachen Pädophilie noch nicht entsprechend reformiert, trotzdem war man weit entfernt von der Gleichgültigkeit des 19. Jahrhunderts, was das Leid angeht, das Kindern angetan wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte wird den Worten des Kindes Gehör geschenkt. Ab den 1980er Jahren reißen mehr und mehr Opfer die Mauern des Schweigen nieder, hinter denen sie sich jahrzehntelang verstecken mussten, und erstmals seit Jahrhunderten erfuhr die Öffentlichkeit davon, wie stark bei ihnen das Gefühl von Selbstentfremdung, von innerer Leere oder des Verlustes des Selbstempfindens ausgeprägt war – eine Begleiterscheinung der erlittenen Vergewaltigung. Während der Live-Fernsehausstrahlung der Sendereihe „Les dossiers de l'écran“ im Jahre 1986 kamen drei Frauen zu Wort, die ausführlich über Missbräuche von den eigenen Vätern oder Brüdern in ihrer Kindheit berichteten. Zwei von ihnen hatten ihren Rücken zur Kamera gewandt, eine Frau namens Eva Thomas hingegen, die bald darauf das Buch „Le viol du silence“ veröffentlichen sollte, zeigte ihr Gesicht ganz frei. „Dass diese Frauen sich ganz offen zu Wort meldeten, ist das Ergebnis eines langsamen Herausbildens von Theorien über die Kindheit, die erst ab Ende des 19. Jahrhunderts entstanden“, unterstreicht Anne-Claude Ambroise-Rendu. „Die Gesellschaft, die willens war, in die Abgründe der kindlichen Seele zu schauen, hat erst nach und nach verstanden, wie stark sich die Traumen, ausgelöst durch sexuelle Übergriffe, auch auf das zukünftige Leben auswirkten.“
Diese Bewusstwerdung warf alle alten Debatten über eine vermeintliche Einwilligung des Kindes über den Haufen. Selbst wenn sie es geschehen ließen, selbst wenn sie keinen ausdrücklichen Widerstand aufbrachten, sich bis heute in Schweigen hüllten – dann nicht deswegen, weil sie damit ihre Zustimmung ausdrücken wollten, wie es jahrhundertelang unterstellt wurde. Nein, es geschah alles nur aus dem einen Grunde, weil sie ihr ganzes Leben lang Opfer waren und Opfer blieben, mit aller ihrer Scham, dem Gefühl der Schande, der Schuld, dem Schrecken und dem Gefühl des Alleinsein. Aber auch wegen der Unfähigkeit, die Tragweite des eigenen erlittenen Leids zu ermessen. Schweigen, sich unterwerfen, nachzugeben heißt nicht einwilligen – das hat man tatsächlich erst Ende des 20., zu Beginn unseres 21. Jahrhunderts begriffen. Das was man damals unter Einwilligung verstand, so erklärten es die Opfer, die Opfervertreter, die Psychiater wie auch die Intellektuellen, war Bestandteil des sozialen Machtgefüges, das für die damalige Gesellschaft konstituierend war. „Der Begriff der Einwilligung sollte zukünftig aus dem besonderen Blickwinkel der moralischen und intellektuellen Einflussnahme betrachtet werden“, so Mary Romero. „Im Falle der Minderjährigen hängt diese Art der Beeinflussung klar mit dem Altersunterschied zwischen Opfer und Täter zusammen. Da es ihnen an Unterscheidungsfähigkeit und Reife mangelt, sind Kinder nicht in der Lage, Nein zu sagen. Es ist darum ein klarer Missbrauch ihrer Autorität, wenn Erwachsene aus dieser Verletzlichkeit und Abhängigkeit Profit schlagen.“
Vanessa Springora hat in ihrem Buch „Die Einwilligung“ (Le Consentement, Grasset 2020), das ihrer Beziehung als 14-Jährige zum damals 50-jährigen Schriftsteller Gabriel Matzneff gewidmet ist, scharfsinnig die Windungen und Wendungen ihrer vermeintlichen Einwilligungen untersucht. „Damals als junges Mädchen meinte sie, sie haben freiwillig dieser Geschichte zugestimmt, aber ihre Zustimmung war Teil der Autoritätsbeziehung gewesen, die notwendigerweise zwischen einem reifen Mann und einer Gymnasiastin entsteht“, erläutert die Essayistin Antoine Garapon. „Ein Meister der Manipulation, hatte Gabriel Matzneff geduldig und unbeirrt auf die sogenannte Einwilligung seines Opfers hingearbeitet, indem er dem Mädchen auf eine verlogene Art immer wieder Komplimente machte und ihn ihm den Wunsch erweckte, eine vollwertige Frau zu sein.“ Die Rechtsprechung will aus dem Grunde das feierliche Verbot jedweder sexueller Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einer unter 15-Jährigen aussprechen, um damit dem Schweigen, den Verletzungen und den vielen Lügen ein Ende zu bereiten. Damit wird das unter Louis-Philippe in der Julimonarchie eingeführte Prinzip des gesetzlichen Alters der Nichteinwilligung wiederbelebt. Noch im 19. Jahrhundert hatte sich die Gesellschaft heftig gegen ein solches Signal zum Schutz des Kindes gesträubt, aber die Zeiten haben sich geändert. Heute scheinen die Franzosen bereit zu sein für die Überzeugung, dass ein Kind niemals freiwillig fähig ist, einer sexuellen Handlung mit einem Erwachsenen zuzustimmen. Doch dazu bedurfte es erst eines langsamen und tiefgreifenden Mentalitätswandels.
Originalartikel „De l'enfant coupable à l'enfant victime, la lente reconnaissance du non-consentement" erschienen am 6. März 2021 in der Printausgabe der Le Monde. Verfasser: Anne Chemin. Erweiterte Übersetzung.
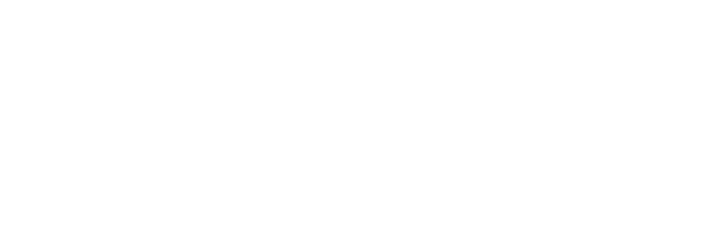
Kommentar schreiben