Erst seit 1997 ist Ricard in seinem Heimatland Frankreich ein Begriff, als er zusammen mit seinem Vater das Buch „Der Mönch und der Philosoph. Ein Dialog zwischen Vater und Sohn“ veröffentlichte. Konzipiert wurde es als Ost-West-Diskussion über zentrale Fragen, die so alt sind wie die Menschheit: der Sinn des Lebens, Bewusstsein, Freiheit und Leid. Zum damaligen Zeitpunkt war Revel, der Vater, ein bekannter französischer Intellektueller und Journalist, er als Sohn aber noch relativ unbekannt. Das Buch wurde ein Bestseller in Europa und in der Folge in 23 Sprachen übersetzt. „Das war schon eine große Veränderung für mich“, sagt er. „Ob damit der Ärger anfing oder es eher der Beginn einer großen Chance war, ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest hat es mir gezeigt, wie absolut künstlich Bekanntheit und Ruhm sein können. Zuerst kennt dich niemand, man weiß nichts über dich, dann aber, innerhalb weniger Wochen, hält man dich mitten auf der Straße fest. Mit meinem Aufzug als Mönch bin ich natürlich auch sehr leicht auszumachen.“
Wir kommen nun auf das Thema zu sprechen, das für ihn quasi zu einem Markenzeichen wurde: Glück und Zufriedenheit. Sein TED-Vortrag „Glücksgewohnheiten“ aus dem Jahre 2004 wurde bis zum heutigen Tag rund 9,5 Mio. Mal auf Youtube gesehen. In diesem Vortrag beschreibt er den Unterschied zwischen Glück als etwas, das man erlernen und kultivieren kann, und Freude, die sehr stark orts-, zeit- und ereignisgebunden ist und die sich immer stärker verflüchtigt, je länger man sie empfindet. „Es gibt heutzutage ein Streben nach hedonistischen Vergnügungen“, erklärt er und verweist dabei auf den geradezu manischen Drang nach Status, Wohlstand und Image und auf ausufernde Soziale Medien als Vehikel der Zurschaustellung des eigenen Narzissmus. „Hedonistisches Vergnügen führt in eine Sackgasse. Es ist wie ein Hamsterrad: Niemals fühlst du eine tiefe Zufriedenheit, du willst eigentlich immer mehr. Wenn du eine Sache bekommen hast, willst du schon die nächste.“
Ricard hingegen plädiert dafür, geistige Resilienz und Zufriedenheit zu kultivieren – bei Aristoteles findet sich dafür der Begriff Eudaimonia, frei übersetzt mit „guter Lebensführung“ (von guten Geistern beseelt), also die persönliche ethisch-moralische Entwicklung durch geistige Übungen mittels Meditation. Er nahm zu diesem Zweck an einer Studie von Richard Davidson, einem Neurowissenschaftler der Universität von Wisconsin-Madison, teil, die zeigen sollte, wie Meditation im Laufe der Zeit neuronale Netze im Gehirn verändern und das emotionale und körperliche Wohlbefinden verbessern kann. Die Forscher verbanden seinen Kopf mit 128 Sensoren und konnten feststellen, dass wenn Ricard zum Beispiel meditativ ein starkes Gefühl von Mitleid entwickelte, sein Hirn eine derart große Anzahl von Gammawellen produzierte, die weit außerhalb des Normbereichs lag – und das auch in Arealen seines Gehirns, die mit Eigenschaften wie positives Denken, Güte und Wohlbefinden assoziiert sind.
Wie steht er eigentlich zu seiner Titulierung als „der glücklichste Mensch der Welt“? „Ich halte es für eine riesen Lachnummer“, sagt er. „Woher wollen Wissenschaftler wissen, wie es um das Glück in den Köpfen der übrigen sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde bestellt ist? So was Verrücktes. Vor allen Dingen weil ja auch gar keine Methode existiert, mit der man Menschen miteinander vergleichen kann.“ Er ergänzt: „Andererseits ist es mir lieber, man nennt mich so, als würde man mich den unglücklichsten Menschen auf Erden bezeichnen. Wie auch immer, es ist und bleibt albern.“ Oft wird er auch gefragt, ob es einen Königsweg zur Meditation gebe. „Es ist wirklich nichts Mysteriöses dabei. Das einzige was zählt, ist Üben“, sagt Ricard. „Jede Lösung, die angeblich den schnellen und einfachen Weg anbietet – seien es „Meditieren in 5 Schritten“ oder „Meditationserfolge in 3 Wochen“ – ist unlauter. Vergessen Sie es. Es ist genau dasselbe wie mit dem Klavierspielen. Sie müssen üben, ein Leben lang. Das ist das wahre Geheimnis. Aber es ist es wert.“
Nachdem die strengsten Corona-Beschränkungen nach und nach gelockert werden, stehen Politiker und Entscheider vor der Mammutaufgabe, eine darniederliegende Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Manche glauben, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, eine „grüne“ und nachhaltige Wirtschaft zu befördern. Andere hingegen warnen davor, dass der Kohleausstieg oder eine zu strenge Umweltgesetzgebung Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze gefährde, und plädieren sogar für eine Verschiebung aller Klimaschutzmaßnahmen. Ricard ist an dem Punkt unmissverständlich: „Der Klimawandel ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wir müssen uns JETZT darum kümmern.“ Die Vorteile, dieses Problem schnell und entschlossen anzugehen, würden die wirtschaftlichen Kosten, die Folgen des Klimawandels einfach zu ignorieren, bei Weitem wettmachen.
Der Himmel über meiner kleinen Hütte im Südwesten Schottlands zieht sich zu. Ein paar Enten lassen sich auf dem See dort unten am Fuße des Hügels nieder. In der Hütte sitzend, folge ich den Ausführungen meines virtuellen Gastes. Lebhaft erläutert er, dass die Reaktion der Regierungen und unserer politischen Führer auf die medizinische Notlage der letzten Wochen und Monate gezeigt hat, wie schnell sich drastische Maßnahmen implementieren lassen und dass die Menschen die Bereitschaft gezeigt haben, diesen Maßnahmen auch zu folgen. Und er ergänzt: „Warum schaffen es die Menschen nicht, mit der gleichen Entschlossenheit noch viel größere Probleme anzugehen? Also Umweltverschmutzung, Klimawandel, die globale Erwärmung und das Artensterben. Jedes einzelne Problem wird weltweit für vielleicht noch mehr Leid und Elend verantwortlich sein.“ Und er appelliert für ein sofortiges Einschreiten. „Noch tut uns die Zukunft nicht weh. Das Problem wird nur sein: Wenn uns die Folgen mit aller Härte treffen, wird es bereits zu spät sein.“
In dem Moment macht sich Ricards Smartphone bemerkbar. Offenbar ist der Akku gleich leer. „Heute habe ich aber einen echt hohen Akkuverbrauch“, lacht er. In unserem Gespräch schauen wir nun in die Zukunft, die kommenden Monate. Ricard hat Jahrzehnte seines Lebens darauf verwendet, Texte und Malereien aus dem Himalayagebirge zu fotografieren und zu katalogisieren, und er hat bereits den Plan, im Herbst dorthin zurückzukehren. Von den alltäglichen Verpflichtungen innerhalb seiner seit 20 Jahren bestehenden humanitären Stiftungen, mit denen er in Indien, Nepal und Tibet Gesundheits-, Bildungs- und soziale Einrichtungen fördert, will er kürzertreten. Jetzt arbeitet er an einem Text, in dem er beschreiben möchte, was es bedeutet, Jahre mit den größten buddhistischen Lehrmeistern zu verbringen. „Ich habe keine großartigen Pläne“, sagt Ricard. „Ich bin jetzt 74, es ist Zeit, dass ich in meine Einsiedelei zurückkehre. Ich möchte nicht in einem Flugzeug sterben, sondern noch ein paar schöne friedvolle Jahre haben. Ich werde mich zufrieden und auch froh auf meinen Tod vorbereiten. Ein schöner Tod ist die Krönung eines guten Lebens. Das hoffe ich zumindest.“
Die Gelassenheit, mit der er das nächste, vielleicht letzte Kapitel seines Lebens aufschlägt, ist ein Spiegel seines buddhistischen Glaubens, dass der Tod ein natürlicher Teil des Lebenszyklus sei. Viele Menschen in unseren modernen westlichen Gesellschaften seien auf den Tod nicht vorbereitet. „Sie denken kaum darüber nach, wie zerbrechlich das menschliche Leben ist“, meint Ricard. „Und sie haben es einfach noch nicht gelernt, die inneren Möglichkeiten zu entwickeln, dem Tod mit Gelassenheit zu begegnen. Im Buddhismus denken wir immerzu an den Tod. Aber es ist nicht morbide, das zu tun. Sondern im Gegenteil: Auf diesem Wege lernen wir jeden einzelnen Moment umso mehr zu schätzen. Warum hört man von so vielen Menschen, die dem Tode nahe noch wenige Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr zu leben hatten, dass es die schönste, reichste Zeit in ihrem Leben war? Weil diese kurze Zeit all das, was den Menschen wichtig und wertvoll erscheint, unvergleichlich stärker bewusst werden lässt. Warum wissen wir nicht unser ganzen Leben lang dieselben Dinge so zu würdigen? An den Tod zu denken, heißt, jeden Moment seines Lebens wertzuschätzen.“
Originalartikel „Eternity is awfully long, especially near the end“ erschienen in der Printausgabe der Financial Times Weekend vom 6./7. Juni 2020, Verfasserin: Harriet Agnew, erweiterte Fassung.
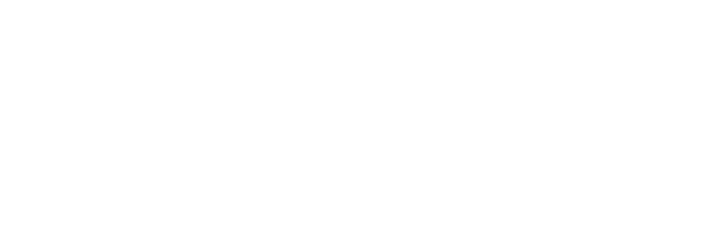
Kommentar schreiben