Der 74-jährige zum Buddhismus konvertierte Biologe und „französische Stimme“ des Dalai Lamas, der mit bürgerlichem Namen Matthieu Ricard heißt, wurde vor Jahren einmal als „der glücklichste Mensch der Welt“ tituliert – und ist diesen für ihn selbst albernen Beinamen bis heute nicht losgeworden. Grund war die Veröffentlichung vor rund 20 Jahren einer Studie über den langfristigen Einfluss von Meditation, an der er bis dato 12 Jahre mitgewirkt hatte. Infolge jahrzehntelangen Trainings hatte er die Struktur seines Gehirns signifikant verändern können – was diese Studie unter anderem zutage förderte. Das Ergebnis löste weltweit ein ungeheures mediales Interesse aus und Heerscharen von Kamerateams und Reportern flogen zu ihm ins Himalayagebirge, um seinem vermeintlichen Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und mussten letztlich doch feststellen, dass es kein Geheimnis gibt, sondern diese Veränderung schlichtweg das Ergebnis unermüdlich harten Trainings war.
In unruhigen Zeiten wie diesen sind Menschen wie er ein idealer Gesprächs- und Interviewpartner. Er selbst hat intensive Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht und insgesamt fünf Jahre seines Lebens in Abgeschiedenheit meditierend verbracht. Kein Wunder, dass er wie nur wenige andere Menschen der Isolation und sozialen Distanz etwas Positives abgewinnen kann und es sogar als etwas „Wundervolles“ bezeichnet. Sein Rat an uns: Schließt Frieden mit euch selbst, dann fühlt sich die Zeit der Leere und des Alleinseins nicht so schwer an. In Anspielung auf Ricards zeitweiliger Abgeschiedenheit hatte ich mich entschlossen, einen meiner persönlich liebsten Rückzugsorte aufzusuchen, um ihn dort virtuell zu treffen: eine kleine Berghütte in der Nähe meines Heimatortes in Südwestschottland. Sie wird gut und gerne dieselben Ausmaße haben wie seine drei Quadratmeter große nepalesische Zuflucht, in der er für gewöhnlich Monate verbringt.
Wir starten unsere Unterhaltung mit einer virtuellen Runde durch unser jeweiliges Umfeld. „Ich wollte schon immer mal gern Schottland besuchen und dort Fotos schießen“, sagt Ricard, der nach Patagonien, Island und Yukon im Nordwesten Kanadas gereist ist, um deren wilde Landschaften zu fotografieren. Fotografien, die sogar von Henri Cartier-Breton gelobt wurden. Ricard schaut sich die kleine Hütte genauer an, wo ich einen kleinen Holztisch mit Essen gedeckt habe. „Es sieht ein bisschen so aus wie eine Einsiedelei“, sagt er zustimmend. Man hört in der Ferne den Ruf eines Kuckucks, nicht ganz so weit entfernt ertönt das Mähen von Lämmern hier am Berghang. „Wenn wir uns letzte Woche verabredet hätten, hätte ich Ihnen das gesamte Himalaya-Gebirge mit vier Achttausendern zeigen können“, kommentiert er seine Eindrücke. „Jetzt aber ist es eher der französische Wald, der zwar auch sehr schön ist, aber bei weitem nicht dieselben Ausmaße hat.“
Ungefähr eine Woche vor unserer virtuellen Verabredung Anfang Mai hat Ricard das Shechen Tennyi Dargyeling Kloster in Nepal verlassen müssen, um mit dem letzten Flug das Land zu verlassen, den die französische Botschaft vor Ort organisiert hatte. Jetzt ist er in die Dordogne in Südwestfrankreich zurückgekehrt und hält sich bei seiner 97 Jahre alten Mutter auf. Er sitzt bei ihr auf dem Balkon und muss Abstand davon nehmen, das Haus während seiner 14-tägigen Quarantäne zu betreten. Ich kann schemenhaft das Innere des Hauses erkennen. „Allô maman“, winkt Ricard seiner Mutter zu. „Maman, on t'a dit bonjour de l'Ecosse.“
Das Mittagessen zählt nicht unbedingt zu Ricards wichtigsten Mahlzeiten am Tag. Sein verstorbener Vater schrieb einmal eine Anthologie der Gastronomie mit dem Titel „Kultur und Küche – eine Reise durch die Geschichte des Essens“, aber als Sohn sei er genau ins Gegenteil geschlagen. „10 Minuten nach dem Essen weiß ich schon nicht mehr, was ich zu mir genommen habe. Es interessiert mich wirklich nicht.“ Ich fülle mir eine große Tasse voll mit dampfender Lauch- und Kartoffelsuppe, Ricard hat vor sich einen einfachen Kopfsalat mit geriebenen Karotten und Mais-Blinis stehen. Ricard ist Vegetarier, „ich möchte nicht für das Leiden und den Tod anderer Tiere verantwortlich sein“, erklärt er seine Haltung. Wie ist seine Meinung zur Corona-Pandemie und den weltweiten Einschränkungen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern, möchte ich von ihm wissen. „Ich glaube, wir sollten wirklich bescheiden sein“, entgegnet er. „Manche Menschen habe enorme Probleme, seien es finanzielle, gesundheitliche, familiäre. Es wäre anmaßend, das in irgendeiner Form altklug zu kommentieren, dass andere Bevölkerungsgruppen enorme Belastungen aushalten müssen.“
Auf der anderen Seite gibt es immer noch einige, denen es materiell gesehen gut gehe, die aber orientierungslos und verunsichert wirken. „Ein submikroskopisches Pünktchen hat unsere Welt aus dem Tritt gebracht und die Illusion zerstört, die der moderne Mensch so mühsam errichtet hat.“ Die Vorstellung, dass wir die äußere Welt kontrollieren können, sei verfehlt, erklärt er. „In uns ist diese unglaublich arrogante Haltung, dass wir uns aus der Natur einfach zurückziehen können. Wir glauben, wir seien die Herren der Welt, wir schicken Menschen auf den Mond, wir beeinflussen unser Erbgut. Fast scheint es, als seien wir unbesiegbar.“ Die Vorstellung von Transhumanismus beispielsweise löse blankes Entsetzen in ihm aus und der Glaube seiner Anhänger, man könne das menschliche Leben dramatisch verlängern. „Stellen Sie sich einen Donald Trump vor, der zum 50. Mal zum amerikanischen Präsidenten gewählt würde. Oder Lionel Messi, wir er sein 50.000. Tor schießt. Wie schrecklich langweilig wäre das.“ Ich lache zustimmend. „So sehr ich den Aufenthalt in meiner Einsiedelei in Nepal liebe“, fährt er fort, „aber doch nicht 1000 Jahre lang! Meine Mutter pflegt immer zu sagen: Die Ewigkeit kann eine schrecklich langwierige Angelegenheit sein, besonders wenn es auf das Ende zugeht.“
Ricards Interesse am tibetischen Buddhismus begann schon in Frankreich. Er wuchs in und im Umland von Paris auf, wurde agnostisch von seinen Eltern erzogen, die den Mittelpunkt eines intellektuellen Zirkels bildeten. Sein Vater, Jean-François Revel, war politischer Kommentator, der dadurch bekannt wurde, dass er sowohl dem Kommunismus als auch dem Christentum kritisch gegenüberstand. Seine Mutter, Yahne le Toumelin, ist eine abstrakte Malerin. Im elterlichen Freundeskreis lernte Ricard einige der größten Künstler der damaligen Zeit kennen, darunter André Breton, der Vater des Surrealismus, den russischen Komponisten Igor Strawinsky oder auch den spanischen Filmemacher Luis Buñuel. „Mich hat damals mehr interessiert, Vögel zu beobachten, Fußball zu spielen oder Musik zu machen. Beim Essen saß ich jedoch mit allen zu Tisch und habe mit halbem Ohr ihren Gesprächen gelauscht“, erinnert er sich. Anfänglich hatte er Probleme, seinen Weg im Leben zu finden. „Erst später wurde mir klar, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen den besonderen Fähigkeiten oder dem Genialischen dieser Berühmtheiten im Hause meiner Eltern und der Tatsache, ein guter Mensch zu sein.“ Einer der besten Freunde seines Vaters war der französische Marxist und Philosoph Louis Althusser, der verrückt wurde und seine Frau tötete.
Ricard war 20, als er eine Dokumentation über buddhistische Mönche in Tibet sah. „Es waren 20 Franz von Assisi, 20 leibhaftige Sokrates unter ihnen.“ Er reiste nach Darjeeling am Fuße des Himalayas, wo seine Auseinandersetzung mit dem tibetischen Buddhismus begann. Seiner Meinung nach hatte er es hauptsächlich seiner Mutter zu verdanken, die das Interesse für Spiritualismus schon in seiner Kindheit in ihm geweckt hatte. Umgekehrt konnte er sie dazu bringen, nach Indien zu reisen, um dort Erfahrungen zu sammeln, die sie ansonsten nur in Büchern fand. Sie folgte seinem Rat und wandte sich in der Folge von ihrem alten Bohème-Leben ab, um eine tibetisch-buddhistische Nonne zu werden. Ricard machte zunächst seinen Doktor in Zellgenetik am Pariser Pasteur-Institut, verbrachte aber alljährlich die Sommerferien in den Bergen Darjeelings. Als er Anfang der 70er Jahre sein Doktorat abschloss, wechselte er ganz in das Himalaya-Gebirge. Über die Vermittlung einer seiner Lehrer lernte er den Dalai Lama kennen.
Im Verlaufe vieler Jahre lernten sie einander kennen, bis er Ricard, der fließend Französisch, Englisch und Tibetisch spricht, das Angebot machte, als sein französischer Übersetzer zu arbeiten. „Es war wundervoll, auch weil es ein so unglaubliches Gefühl ist, so nahe mit dem Dalai Lama verkehren zu dürfen. Das Besondere an ihm ist, dass er jedem Menschen gegenüber derselbe bleibt – ob bei einem Staatsoberhaupt oder bei einem Zimmermädchen“, meint Ricard. Er erzählt davon, wie er den Dalai Lama beim Besuch des damaligen französischen Präsidenten François Mitterand in den Elysee-Palast begleiten durfte. „Normalerweise setzt man sich nach einem solchen Treffen in die Limousine, der Präsident sagt Auf Wiedersehen und das wars. Nicht so beim Dalai Lama, der im Innenhof des Elysee-Palastes hin und her ging, den Wachen die Hand schüttelte, ihnen auf die Schultern klopfte und mit ihnen scherzte. Mitterrand wusste gar nicht, wohin mit sich.“ Der Dalai Lama lebt in Indien, seinem dauerhaften Exil von Tibet. Ricard lässt sich nicht auf die Frage ein, was er über das Verhältnis zwischen China und Tibet denke, und meint nur: „Ich hoffe sehr, dass ich eines Tages nochmal nach Tibet komme, bevor ich sterbe.“
Originalartikel „Eternity is awfully long, especially near the end“ erschienen in der Printausgabe der Financial Times Weekend vom 6./7. Juni 2020, Verfasserin: Harriet Agnew, erweiterte Fassung.
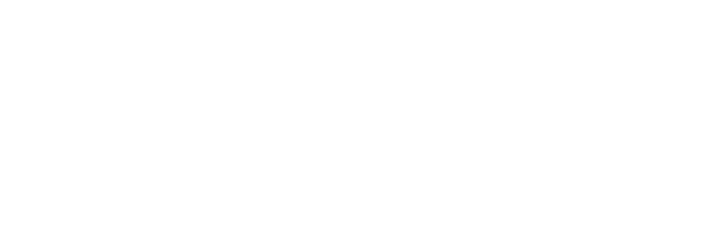
Kommentar schreiben